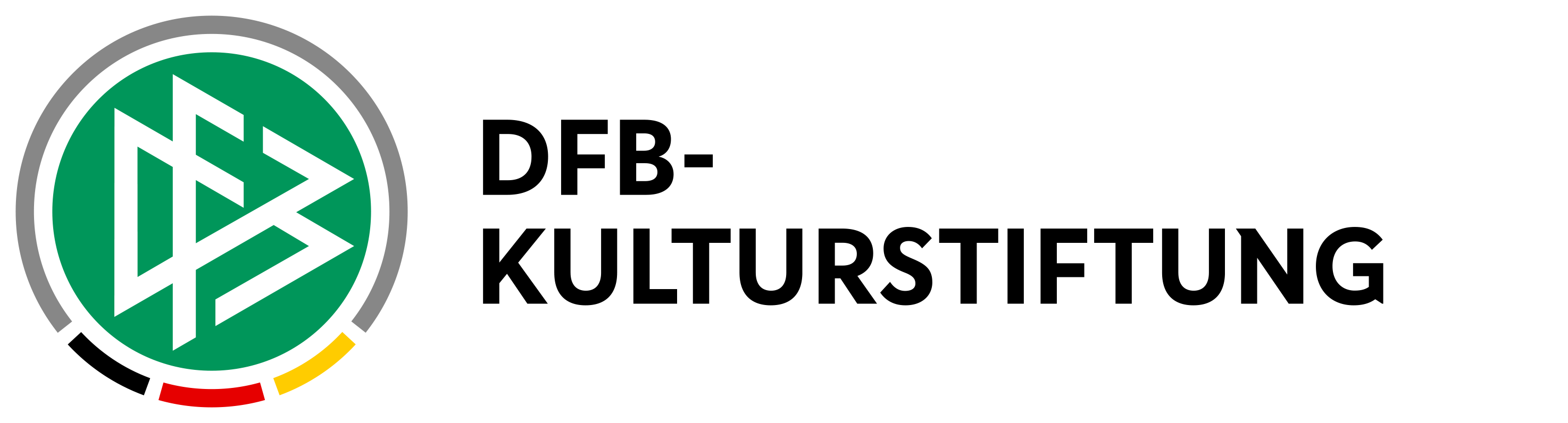

Fußball – Mehr als ein Spiel. Um die Vielfältigkeit des Fußballs ging es am Wochenende bei mehreren Panels der DFB-Kulturstiftung auf und abseits der Leipziger Buchmesse. Moderiert von Stiftungskuratorin Josephine Henning standen am Sonntag im „Trendforum Bildung“ in Messehalle 2 mit Nachhaltigkeit, KI, Rassismus und dem Wandel von Trikots interessante und trotz ihrer Bedeutung für viele Zuhörer*innen neue Themen auf dem Programm.
Bereits am Messe-Samstag richteten sich zwei Lesungen der Kinder- und Jugendbuch-Autoren Boris Pfeiffer und Fritz Fassbinder an eine jüngere Zielgruppe. Sie lasen im Familienzentrum Tüpfelhausen in Leipzig-Leutzsch aus ihren aktuellen Fußball-Titeln „Die Bagaluten-Bande. Unsinkbar. Das Geheimnis der Hansa-Kogge“ bzw. „Die Wärme der Wölfe. Und wenn wir verlieren, dann schlagen wir zu“. Die Detektivgeschichte des bekannten Autors der „drei ??? Kids“ und die ernstere Erzählung aus der Hooliganszene des Fußballs zeigten auf nahezu exemplarische Weise das vielfältige Spektrum von Büchern. Beide Bücher sind für den „Lese-Kicker“, den Preis für das beste Fußball-Kinder- und Jugendbuch des Jahres nominiert, der am 6. Mai von der DFB-Kulturstiftung in Frankfurt verliehen wird. Aber zurück zur Buchmesse.

Anstoß für einen grüneren Fußball: Beitrag von Amateurvereinen zum Klimaschutz
Zum Auftakt begrüßt die ehemalige Nationalspielerin, Künstlerin und TV-Expertin Josephine Henning mit Anton Klischewski vom FC Internationale Berlin und Simon Rasch, DFB-Nachhaltigkeitsmanager, zwei Praktiker aus dem Vereins- und Verbandswesen zu einem brennend heißen Thema: Beitrag des Fußballs zum Klimaschutz. Der Klimawandel zeigt sich nämlich nicht nur in steigenden Meeresspiegeln oder abschmelzenden Gletschern, sondern auch auf dem Fußballfeld. Zu Beginn des Talks erinnert sich die Nationalspielerin, wie sie schon vor Jahren bei einem Turnier in Chile in der Halbzeit die heißverklumpten Teilchen des Kunstrasenfeldes mit dem Schraubenzieher von ihren Fußballschuhen kratzen musste. Dass extreme Wetterbedingungen den Outdoorsport Fußball auch hierzulande immer massiver beeinflussen, ist längst kein Zukunftsszenario mehr. Ebenso wenig die Notwendigkeit, sich als Verein und Verband mit Themen wie Wassermangel oder der eigenen Klimabilanz zu beschäftigen. Denn die ist bei zigtausenden Fußballspielen jedes Wochenende ein echtes Thema. Während Rasch das DFB-Projekt „Anstoß für Grün“ und den bei der UEFA EURO 2024 mit acht Millionen Euro eingerichteten Klimafonds vorstellt, beschreibt Klischewski, wie komplex, am Ende aber auch lohnend es sein kann, wie der FC Internationale, Trikots nachhaltig herzustellen. Inzwischen lässt der Berliner Landesligist seine Hemden und Hosen nämlich in Portugal produzieren, statt in Südostasien. „Cradle to Cradle-Goldstandart“, freut sich Klischewski – und stellt unter dem Beifall des durchgehend gut gefüllten „Trendforums Bildung“ die Frage, wann dies im Profibereich auch Standard wird.
Der Wandel von Fußballtrikots und ihre Bedeutungen: Popkulturelles Statement, politische Botschaft und Modephänomen
Womit das Thema „Trikots“ aufgerufen ist. In der weltweit für einen nicht unwesentlichen Teil der Klimabelastung verantwortlichen Fashionindustrie steht das Thema Nachhaltigkeit schon lange ganz oben auf der Agenda. Unter anderem darum ging es in dem Panel mit Dr. Laura Pollack, Projektmanagerin der DFB-Kulturstiftung, und dem Journalisten und Trikot-Fan Matthias Scherer. Aber Fußballtrikots sind ein viel zu spannendes und vieldeutiges Stückchen Stoff, um, trotz ihrer Wichtigkeit, nur die Nachhaltigkeit zu betrachten. Anhand von nationalen und internationalen Trikots stellen die Gäste dar, wie sich das Trikot seit Beginn des Farbfernsehens und der Entdeckung seiner massenweisen Verkaufbarkeit zwischen Mode, Popkultur, Marketing, Politik und Identität zu einem sowohl gestalterisch als auch gesellschaftspolitisch aufgeladenen Objekt entwickelte. Ob als hippes Modestatement von Models und Influencern oder als Medium für soziale und gesellschaftspolitische Kampagnen – das Fußballhemd ist längst mehr als ein Stück Arbeitskleidung. Und das nicht erst seit dem Mega-Erfolg des pinken Auswärtstrikots der Nationalmannschaft zur UEFA EURO 2024 und der schon heute ikonischen Werbekampagne seines Herstellers Adidas.

Künstliche Intelligenz im Profifußball: Wird Technik zukünftig Leistung dominieren?
Früher eher ein „Nerd-Thema“, heute ein „Game-Changer“, der das Spiel massiv verändert: Datenanalyse und KI. Jun.-Prof. Dr. Pascal Bauer, Leiter des DFB-IT-Clusters Sport und Juniorprofessor für Sportinformatik, spricht in seinem Panel anschaulich über die Chancen und Herausforderungen von KI im Fußball. Auf der einen Seite haben die vielen während eines Spiels erhobenen Daten einen hohen Nutzen: für Entscheidungsfindung in Talentförderung und Spielen, im Scouting oder in der Spielanalyse. Auf der anderen Seite steht die Frage der ethischen Vertretbarkeit, Daten einzelner Spieler*innen zu erheben, zu nutzen und zu speichern. Denn diese können auch über deren Zukunft entscheiden. Trotz oder gerade wegen dieser Bedenken wünscht sich Bauer eine Auseinandersetzung mit KI und der hohen Datenverfügbarkeit im Alltag. Gleichzeitig zeigt er sich skeptisch, ob KI, der manche fast magische Entwicklungssprünge zutrauen, den Fußball demnächst komplett umkrempelt. Seiner Expertise nach werde die Einflussnahme von Trainer*innen am Spielfeldrand auch in Zukunft wichtiger bleiben als die Daten und KI selbst.
Spielfeld der Herrenmenschen. Wie rassistisches und kolonialistisches Denken den europäischen Fußball bis heute prägt
„Ey Schwester, du weißt nicht, was es bedeutet, dass du hier bist.“ Diesen Satz hört Rachel Etse, Trainerin in der rassismuskritischen Bildungsarbeit häufig von Schwarzen Menschen, die an ihren Workshops in den Nachwuchsleistungszentren der Bundesliga teilnehmen. Er verdeutlicht, wie wichtig es ist, bei der Aufklärung über Rassismus betroffenenzentriert zu arbeiten und diskriminierten Menschen selbst eine Stimme zu geben. In über 100 Interviews, die Ronny Blaschke für sein Buch „Spielfeld der Herrenmenschen“ führte, macht er genau das. Er lässt Personen zu Wort kommen, die Rassismus im Fußball erfahren haben, als Spieler*innen, Schiedsrichter*innen oder Journalist*innen. Diese Geschichten zeigen: Rassismus ist real. Wir alle sind geprägt von rassistischen und kolonialistischen Strukturen. Sie beeinflussen unser Denken und Handeln. Trotz der unangenehmen Gefühle sollten und müssen wir uns damit auseinandersetzen. Mit diesem Wunsch schließen Etse und Blaschke das Panel. Und zwar nicht nur bezogen auf Anti-Schwarzen Rassismus, sondern auch auf antimuslimischen Rassismus, Antiziganismus, antiosteuropäischen Rassismus und alle anderen Formen von Rassismus.
